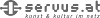Kulturindustrie im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit
Von Dietmar Dath stammt eine der interessanteren Einwände gegen Adornos und Horkheimers Kritik der Kulturindustrie. Wenn er den Begriff verwende, heißt es in seinem Briefromanessay Die salzweißen Augen, dann jedenfalls nicht im pejorativen Sinne; als Freund des Fortschritts zöge er Industrie dem mittelalterlichen Handwerk allemal vor. Als Polemik gegen das linksalternative Spießertum, das in seiner Abscheu vor Hollywood und ›US-amerikanischer Plastikkultur‹ alles Mediokre und Bodenständige – Kleinkunst, handgemachte Rockmusik und sozialdemokratische Gesinnungslyrik – goutiert, hat das fraglos seine Berechtigung. Indem Daths Verdikt die Small-und-provinziell-is-beautiful-Ideologie einfach nur umdreht, bleibt es jedoch selbst noch empiristisch befangen. Historischer Fortschritt ist nun einmal nicht am je einzelnen Produkt festzumachen: weder am Vergleich von Morgenstern und chemischer Keule noch an dem von selbstgemachter Marmelade und ›Schwartaus Bester‹ – und ebensowenig auch an dem von Wanderbühne und Blockbuster. Zu bestimmen ist er allein gesamtgesellschaftlich, als die durch Verwohlfeilung der Produktion ermöglichte Entlastung von der tagtäglichen Fron.
Das Lob der Massenproduktion gerät dabei umso plausibler, je lebensnotwendiger die produzierten Güter sind: Lieber fließend Wasser als das Plumpsklo im Hinterhof, und dass früher, vor der Industrialisierung der Landwirtschaft, das Fleisch angeblich besser geschmeckt haben soll, wird denen, die auf Kartoffeln und Hirsebrei beschränkt waren, herzlich egal gewesen sein. Umgekehrt macht das Argument umso weniger Sinn, je mehr das, was produziert wird, sich selbst Zweck genug ist. Kunst braucht niemand zum Überleben, und gerade darum ist sie Ausdruck dessen, was mehr wäre: Erfahrung von Individualität. Streamlining schlägt ihr deswegen nicht bloß, wie bei der Marmelade, zum Nachteil an, sondern ist mit ihr schlechthin unvereinbar – gleich, ob es sich um die nach Schema F heruntergedrehte Krimiserie handelt oder um die aus der Romantik bekannten Herzschmerz-Gedichte von der Stange.
Und wirklich findet in der Kulturindustrie industrielle Produktion im Wortsinne kaum irgend statt. Bei seiner Besichtigung der Babelsberger Filmstudios, schrieb Adorno an Benjamin, sei ihm vor allem aufgefallen, wie wenig doch die spezifischen technischen Möglichkeiten des Films zum Einsatz kämen; und statt tayloristischer Fließbandarbeit steht gerade hinter den erfolgreichsten Filmen, Fernsehserien und Computerspielen der zum Markenzeichen geronnene Name des Originalgenies, aus dessen Kopf die Konzeption des Ganzen entsprang. Wenn überhaupt von technischen Verfahren zur Aufwandsersparung sinnvoll die Rede sein kann, dann nicht im Bereich der Produktion neuer, sondern der der Reproduktion bereits vorhandener Werke – genau dort also, wo sie die ganz und gar kunst- wie technikferne Illusion befestigen sollen, sie imitierten bloß das echte Leben. Während die Werke handhabbar gemacht, auf Bildschirmgröße, Zimmerlautstärke und Coffee-Table-Format verkleinert werden, wird zugleich der erzbürgerliche Kult des Bildungserlebnisses reproduziert: Pavarotti in New York, und ich bin live dabei!1
Dath, so ließe sich der Einwand zusammenfassen, missversteht als deskriptiv, was doch nur polemisch zu verstehen ist. Indem er aus dem Begriff der Kulturindustrie die Industrie isoliert, entgeht ihm die eigentliche Pointe, dessen Abgründiges: die Verschmelzung zweier sich eigentlich polar gegenüberstehender Sachbereiche, vulgärmarxistisch gesprochen: von Basis und Überbau. Während Industrie die instrumentelle Bearbeitung von Naturzwängen meint, so steht Kultur – bei allen Ambivalenzen, vom trüben Ursprung im Ackerbau bis zur heutigen Verwendung als Tarnbegriff für Volk und Ethnie – für den Überschuss über das bloß Kreatürliche. Kulturindustrie lässt beides in eins fallen. Was die Steigerung der Produktivkräfte den Menschen an Möglichkeiten eröffnet, verschließt sie, indem sie diese einzig als Mittel der Alltagsbewältigung zur Geltung bringt: Fernsehen lässt niemanden, wie Adorno es erhoffte, wirklich in die Ferne schauen, sondern verdoppelt nur das Altbekannte. So gelingt Kulturindustrie das Kunststück, die Freiheit des Individuums, die das Kapitalverhältnis stets voraussetzen muss und doch nicht zu ihrem Recht kommen lassen darf, reibungslos fürs Ganze nutzbar zu machen.
Die industriellen Produktivkräfte kommen in Kulturindustrie daher stets nur als Schein, als bloßes Als-ob vor. Zwar setzt sie beständig Technik in Szene – aber als etwas den Menschen Fremdes, Bestaunenswertes. Was sie, wie es so schön heißt, zum Kult erhebt, sind ja nicht bloß die mit unverwechselbarem Gesicht, einzigartiger Stimme oder angedrehtem Charisma ausstaffierten Stars, sondern längst genauso die jeweils angesagten Geräte und Verfahrensweisen: Special effects, I-Phones oder die Fender Stratocaster, auf deren Klang der Fan schwört, auch wenn er sie von dem einer Gibson nicht unterscheiden kann. Die Fetischisierung der Mittel beschränkt sich dabei nicht auf den einzelnen, mit der Aura des Unvergleichlichen ausgestatteten Massenartikel, sondern zielt, wichtiger noch, auf den Zusammenhang des Ganzen. Der technische Fortschritt erscheint in der Kulturindustrie als sein genaues Gegenteil: als schicksalshafter, dem bewussten Eingriff entzogener Vollzug.
Diese Mystifikation der Technik – als wären es die Dinge selbst, die über ihre Bedeutung entschieden, und nicht ihr gesellschaftlicher Einsatz – kehrt auch im Nachdenken über sie wieder. Symptomatisch stehen dafür zwei jüngst in der renommierten ›Zur Einführung‹-Reihe bei Junius erschienene Bände, die sich der Fernsehtheorie und den Theorien des Computerspiels widmen. Man liest darin mancherlei Apartes, etwa über die »Fernbedienung als philosophische Apparatur« oder über das Zusammenspiel von »ludologischen Ansätzen, narrativen Untersuchungen und Presence- oder Immersionskonzepten«. Nichts aber über Marktaufkommen, Arbeitsbedingungen und Besitzverhältnisse; ganz, als würden die Kulturwaren in einem eigenen, von gesellschaftlicher Vermittlung ungetrübten Paralleluniversum existieren. Es ist dies die bewährte Strategie von Geisteswissenschaftlern: Von den naturwissenschaftlichen Kollegen als Schwätzer beargwöhnt, ständig von Mittelkürzung und der Angst vor der eigenen Überflüssigkeit bedroht, müssen sie sich und anderen ständig beweisen, immer auf dem neuesten Stand zu sein, und führen daher ständig hochanregende Diskurse über die neuesten Hip-Trends – das aber auf genau die gleiche erbauliche Weise, in der es anno dunnemals über Goethe, Schiller und den deutschen Geist ging: in der Form des Besinnungsaufsatzes. Statt dass Denken sich an der Heteronomie der Sache erprobt, muss es noch Fernsehen und Computer, um ihnen die höheren Weihen des akademisch würdigen Gegenstands zu verleihen, sich gleich machen – als Produkte reinen Geistes.
Neben der klassischen, in VersorgerIn Nr. 95 diskutierten Nörgelei, Adorno und Horkheimer missgönnten den ›kleinen Leuten‹ ihr harmloses Vergnügen, existiert im zeitgenössischen Geistesbetrieb folgerichtig auch noch eine zweite Variante, die Einsichten Kritischer Theorie zu negieren. Diese kann die Bedeutung von Kino, Fernsehen und Internet gar nicht hoch genug ansetzen. Medien nämlich seien es, die die Welt im innersten zusammenhalten, wenn nicht gar ihre materiale Gestalt in Zeichen, Simulakren und Datenströme auflösen – was dann, je nach Standpunkt, als Beginn des Global Village oder als endgültiger Niedergang des Abendlandes verstanden werden darf.
Gerade das Aufkommen der Neuen Medien, die so genannte »digitale Revolution«, verleitet zu derartigen Interpretationen. Deren Versprechen besteht in ihrer Unmittelbarkeit: Alles soll bloß einen Mausklick entfernt sein, rundum vernetzt und gestochen scharf, dabei aber – unbeschwert von der Trägheit der Materie – unendlich manipulierbar. Ausgerechnet in den digitalisierten Kulturwaren, von der DVD zum I-Pod und von der Playstation zum World Wide Web, feiert der deutsche Idealismus die Hybris vom Vorrang der Idee über die Materie, seine Wiederauferstehung. Nicht zuletzt die Hippies und Alternativen sahen, sofern sie nicht gänzlich der »Idiotie des Landlebens« (Marx) anheimgefallen waren, durchs Internet ihre Stunde gekommen: Die Vernetzung löse die alten Hierarchien auf, erlaube Dezentralisierung und effektive Selbstverwaltung; jeder könne dort als Autor, Künstler oder Dokumentarfilmer reüssieren, und mit Fileshare und Open-Source-Programmen sei dem Privateigentum ein virtueller Todfeind erwachsen.
Tatsächlich ist bemerkenswert, wie wenig Autoren, die sich der Kritischen Theorie verpflichtet wähnen, deren Kritik der Kulturindustrie fürs digitale Zeitalter fortzuschreiben versuchen. Wird deren Programm überhaupt noch aufgenommen, wie in den vom Verbrecher-Verlag veröffentlichten Aufsatzbänden Alles falsch und Zum aktuellen Stand des Immergleichen, hält man es lieber traditionell mit Film, Funk und Fernsehen. Zu den wenigen, die die Herausforderung angenommen haben, gehörte Robert Kurz. Sein in Exit! Nr. 9 erschienener Aufsatz über »Kulturindustrie im 21. Jahrhundert«, eine der letzten vor seinem Tod publizierten Arbeiten, ist eine über weite Strecken brillante Beweisführung, wie wenig Adornos und Horkheimers Kritik durchs Aufkommen der Neuen Medien widerlegt ist, wie sehr vielmehr der in der Dialektik der Aufklärung diagnostizierte totalitäre Zug der Kulturindustrie im Internet als »integralem Gesamtkunstwerk«, das noch jede Lebensäußerung in sich aufsagt, kulminiert.
Ausführlich widerlegt Kurz das Gerücht von der virtuellen ›Umsonst-Kultur‹. Schon ein Blick auf das im Netz umgesetzte Kapital kann einen dabei skeptisch machen.2 Ohnehin aber meint Kritische Theorie, wenn sie vom Warencharakter der kulturindustriellen Produkte spricht, nicht einfach, wie es das verbreitete Missverständnis will, die Tatsache, dass mit ihnen Profit gemacht wird. Für den Markt mussten die Künstler, und nicht bloß zu ihrem Nachteil, seit Anbeginn des bürgerlichen Zeitalters produzieren. Spezifisch für Kulturindustrie aber ist der Durchschlag der Warenform auf das Produkt: die Einfühlung des Konsumenten in den Tauschwert. Ob dieser fürs Konzert von David Garrett hundert Euro ausgibt oder sich den Mitschnitt illegal herunterlädt, ist daher zweitrangig (und vielleicht erscheint der Genuss des gesparten Geldes sogar größer als das des ausgegebenen; Geiz ist bekanntlich geil). Kurz zitiert in diesem Zusammenhang die entscheidende Passage der Dialektik der Aufklärung: »Schon heute werden von der Kulturindustrie die Kunstwerke, wie politische Losungen, entsprechend aufgemacht, zu reduzierten Preisen einem widerstrebenden Publikum eingeflößt, ihr Genuß wird dem Volke zugänglich wie Parks. Aber die Auflösung ihres genuinen Warencharakters bedeutet nicht, daß sie im Leben einer freien Gesellschaft aufgehoben wären, sondern daß nun auch der letzte Schutz gegen ihre Erniedrigung zu Kulturgütern gefallen ist.«
Charakteristisch für die Form, in welcher der Tauschwert sich in die Kulturware einschreibt, ist daher weniger deren Preisschild als das, was eingangs beschrieben wurde: der Zusammenfall von Arbeit und Freizeit. »Amusement«, heißt es bei Horkheimer und Adorno, »ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Es wird von dem gesucht, der dem mechanisierten Arbeitsprozess ausweichen will, um ihm von neuem gewachsen zu sein. Zugleich aber hat die Mechanisierung solche Macht über den Freizeitler und sein Glück, sie bestimmt so gründlich die Fabrikation der Amüsierwaren, daß er nichts anderes mehr erfahren kann als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst. Der vorgebliche Inhalt ist bloß verblaßter Vordergrund; was sich einprägt, ist die automatisierte Abfolge genormter Verrichtungen. Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen nur in der Angleichung an ihn in der Muße.« Darin, mehr als alles andere, besteht der Schlüssel zum Computer als dem neuen kulturindustriellen Leitmedium. In dem verdienstvollen Aufsatzband Digital Labor findet sich dazu einiges an Material. Die versammelten Autoren erinnern nicht bloß an die gern verdrängte Tatsache, dass die IT-Branche ein Hort der Überausbeutung ist3; sie verweisen vor allem auch auf das ungeheure Ausmaß an unbezahlter Arbeit, die freiwillig im Netz geleistet wird. Wofür Firmen früher einmal Softwareentwickler, Produkttester oder Reiseberichterstatter engagieren mussten, wird heute von Heerscharen von Internetaktivisten als Gratis-Dienstleistung zur Verfügung gestellt, genau wie die unzähligen Daten auch, auf denen Unternehmen wie Facebook ihren Marktwert aufbauen. In der rastlosen Vernetzung von allem mit allem verwirklicht sich, wonach Kulturindustrie seit jeher strebte: die Arbeit am großen Ganzen, am Gemeinwohl als Hobby.
Mit dem Computer soll den Lohnabhängigen nach Feierabend ausgerechnet das Gerät zum Unterpfand ihrer Autonomie avancieren, das ihnen tagsüber als Materiatur dessen, was das Kapital von ihnen fordert, gegenübertritt. Genau das spiegelt sich in der kulturindustriellen Nutzung wider. Der Eifer, mit dem Spiele gezockt und Netzwerke frequentiert werden, überhaupt die Energie, die in die Beschäftigung mit neuer Technik – vom Navi bis zum Smartphone – gesteckt wird, speist sich nicht zuletzt aus insgeheimer Angst: aus der allzu glaubwürdigen Drohung, mit der Technik nicht mehr mitzukommen und darum auf dem Arbeitsmarkt zum alten Eisen zu gehören. Jede Eingabe, die zum Ziel führt, jede erfolgreich abgeräumte Tetris-Reihe und jede neu gemeisterte Funktion des neuen Smartphone bestätigt dem User, was er, aus guten Gründen, sich doch nie ganz glauben wird: Herr über das Gerät zu sein.
Gerade beim Computerspiel gehört daher, ob Adventure oder Ego-Shooter, die Herstellung einer permanenten Testsituation, die unablässige Produktion von Stress, zum Formgesetz – ohne dass es komplementär zu einer Entspannung käme. Die Aktivität des Spielens zerfällt in zahllose zu bewältigende Aufgaben, deren Lösung die richtige Eingabe oder den richtigen Tastendruck erfordert; fließend daher der Übergang zu jenen von Firmen geforderten Einstellungstests, die etwa nach dem Prinzip von ›Dr. Kawashimas Gehirnjogging‹ aufgebaut sind. Das Spiel erlaubt daher gerade nicht, wie der erwähnte Einführungsband es nahelegt, sich narrativ eine Geschichte zu erschaffen; sondern, ganz im Gegenteil, sich auszukoppeln aus Raum und Zeit. Kaum ein Spieler, der nicht schon einmal die verstörende Erfahrung gemacht hätte, wie über das ›nur noch dieser eine Durchgang‹ ganze Stunden spurlos verschwinden können – ohne dass sie, wie im Falle des atemlos verschlungenen Romans oder der durchzechten Nacht, als erfüllte noch zu vergegenwärtigen wären. Wenn Kulturindustrie sich behilflich dabei zeigt, die Zeit totzuschlagen, so ist das durchaus wörtlich zu verstehen.
Gegen das kurrente Gerede von der Interaktivität hat Robert Pfaller den schönen Begriff der »Interpassivität« geprägt. Gedacht ist dabei an die Delegation von dem, was gemeinhin zum Persönlichsten und Subjektiven gerechnet wird. So, wie man sich freut, dass das Konservendosengelächter in der Sitcom einem das Lachen abnimmt, ist man gleichfalls dankbar dafür, die unzähligen Sendungen, die keinesfalls verpasst werden dürfen, gar nicht selber gucken zu müssen, weil man sie ja aufgenommen hat. (Die linke Variante der Interpassivität ist die Rundmail: Liest man etwas Empörendes, das eigentlich Protest erfordern würde, schickt man einfach den Link herum, am besten an Leute, von denen man weiß, dass sie ihn wiederum selber weiterleiten werden.) Leider unterminiert Pfaller selbst den analytischen Gehalt, indem er in einem neueren Werk zur Ästhetik der Interpassivität die Sache flugs zur künstlerischen Strategie hochjubelt – zu einem Betätigungsfeld für werdende Mitglieder des Kulturbetriebs also, denen es bislang noch am richtigen Alleinstellungsmerkmal fehlte. Gerade das Beispiel des Computerspiels zeigt schließlich, wie wenig die manische Aktivität ein Gegenstück zur entsubjektivierten Stasis bildet; wie wenig überhaupt das virtuelle Schöpferpathos, das Selbstbild vom überlegenen Geist, der die Maschine sich unterwirft und mit nichts als ein paar eingetippten Befehlen Wirklichkeiten schafft, von der Unterwerfung unter die Übermacht der Apparatur zu unterscheiden ist. Einer Menschheit ohne Angst fiele vielleicht die Technik als Erweiterung ihres organischen Leibes zu; unter gegebenen Verhältnissen aber ist es die Technik selbst, die sich des Körpers bemächtigt und ausspeit, was sie nicht brauchen kann.
Wie in digitaler Kulturindustrie Aktivität und Passivität zusammenfallen, so auch der Gegensatz von Integration und Zerfall. Auch das bedeutet an sich nichts Neues; die mächtigsten Massenwirkungen, wusste schon die Propagandamaschinerie der Nazis, entfalten sich nicht beim Aufmarsch, sondern unter den atomisierten Einzelnen vorm Volksempfänger. Heute bedarf es dazu freilich keiner zentralen Instanz mehr. Während die Menschen via Facebook, Twitter und unüberhörbarer Handy-Telefonate in der Öffentlichkeit noch ihre banalsten Lebensäußerungen der Allgemeinheit mitteilen, als bräuchten sie unablässig die Bestätigung, dass es sie immer noch gibt, sorgen sie zugleich mit allen Mitteln dafür, zu ihresgleichen auf Distanz zu gehen. Die anderen ertragen wir nur in der Masse, und am besten medial gefiltert; das einzelne Subjekt aber rückt uns mit seinen Ticks, seinen Wünschen, seinen Eigenheiten, kurz: seinem Begehren zu sehr auf die Pelle.
Sardonisch verwirklicht sich gesamtgesellschaftlich, was die Propagandisten des Netzes als dessen Vorzug anpreisen: Jeder ist sich sein eigener Kulturindustriebetrieb. Als solcher aber steht er zu allen anderen in Konkurrenz. Nicht zufällig ist, wie von Metz und Seeßlen analysiert, das derzeit beliebteste Format des Kapitalismus als Spektakel die Casting-Show. Ihr Gehalt ist nicht, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, die Aktualisierung des alten Rührstücks ›Vom Tellerwäscher zum Millionär‹. Sie soll also weder, wie von Kracauer beschrieben, die sprichwörtlichen »kleinen Ladenmädchen« davon träumen lassen, wie sie mit ein bisschen Glück und Gesangstraining groß herauskommen könnten; noch aber, wie Adorno gegen ihn einwandte, den Zuschauern das entlastende Eingeständnis ermöglichen, dass sie es selber nie so weit bringen werden. Sie dienen, mit anderen Worten, nicht der Trauer über das eigene Scheitern, sondern der Häme über das der anderen – weswegen das sozialdarwinistische Setting auch gar nicht schikanös genug sein kann.
So übertrifft Kulturindustrie noch die schwärzesten Diagnosen ihres schärfsten Kritikers. In späteren Texten hatte Adorno vorsichtig seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, die Kulturindustrie verlöre langsam ihre Macht über die ihr Unterworfenen, weil diese begännen, ihre Schäbigkeit zu durchschauen. Heute schreit sie ihre Infamie offen heraus, ohne dass die Desillusionierung ihr Schaden zufügte. Im Gegenteil: Gerade der Typus des Abgebrühten, der nichts kauft, weil eh alles Schwindel sei, ist Produkt, nicht Widerpart der Kulturindustrie. Sich dem Pöbel, der sich bei Talkshows und ›Deutschland sucht den Superstar‹ freiwillig zum Affen macht, überlegen fühlen zu dürfen, ist das ultimative narzisstische Angebot des Mediums an den Zuschauer: Statt mit den armseligen Gestalten, die es vorführt, identifiziert er sich mit der Apparatur, die auf sie hinabblickt. Hoffnung gewährt daher nicht der Drübersteher, der sich etwas Besseres wähnt, sondern, ganz im Gegenteil, diejenigen Konsumenten, die das, was sie konsumieren, ganz ernst nehmen. Indem sie der kulturindustriellen Manipulierbarkeit von Leib und Seele innewerden, vermögen sie vielleicht die Erfahrung machen, für die einmal die Kunst einstand: dass es möglich ist, bei sich selbst nicht ganz zu Hause zu sein.
Literatur
Robert Pfaller, Ästhetik der Interpassivität. Hamburg: Philo Fine Arts 2008, 366 S., 18,00 Euro
Exit! Kritik und Krise der Warengesellschaft, Nr. 9. Berlin: Horlemann 2012, 199 S., 13.00 Euro
Markus Metz u. Georg Seeßlen, Kapitalismus als Spektakel. Berlin: Suhrkamp 2012, 91 S., 5,99 Euro
Trebor Scholz (Hg.), Digital Labor. The Internet as Playground and Factory. London (u.a.): Routledge 2012, 258 S., 26,95 Euro
Lorenz Engell, Fernsehtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius 2012, 255 S., 15,90 Euro
GamesCoop, Theorien des Computerspiels zur Einfühlung. Hamburg: Junius 2012, 212 S., 14,90 Euro
[1] Wohlmeinende Reformer begreifen das gerne als Angriff aufs Bildungsmonopol, welche Kunst in der Vergangenheit, zu ihrem unbezweifelbaren Schaden, zum Privileg der happy few machte. Auch der Autor ist froh, nicht warten zu müssen, wann ein anständiges Ensemble einmal Station in seiner Zwei-Millionen-Provinzstadt macht, sondern sich CDs übers Internet bestellen zu können. Er meint aber doch, die bessere Art, das Bildungsprivileg zu schleifen, sei die, die Massen von der sinnfreien Schufterei zu befreien, als sie für den Feierabend mit schäbigen Aufnahmen der ›schönsten Arien aus Aida‹ abzuspeisen. Wie heißt es bei Pohrt doch so richtig: Lieber gar kein Buch als zehn Konsaliks und die tägliche ›Bild‹-Zeitung.
[2] Pläne des amerikanischen Kongresses, die Betreiber von ›social networks‹ für etwaige auf ihren Seiten begangene Copyright-Verletzungen schärfer zur Verantwortung zu ziehen, scheiterten Anfang dieses Jahres an einer konzertierten Protestaktion; als deren zentrales Argument erwies sich der schlichte Hinweis, wessen Anteil am Bruttosozialprodukt höher ist: das der Film- und Plattenindustrie oder das der Neuen Märkte. Die Mehrheit der Abgeordneten zeigte sich in Rekordzeit überzeugt.
[3] Programmierer, deren gewerkschaftliche Organisierung auf zahlreiche praktische wie ideologische Widerstände stößt, müssen sich, vor allem in den viel gefeierten Schwellenländern wie Indien, in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl in den denkbar prekäresten Arbeitsverhältnissen durchschlagen.