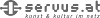40 Jahre No Future
Obwohl über die tatsächliche Geburtsstunde des Genres durchaus Uneinigkeit herrscht, wird Punk heuer offiziell Vierzig. Begleitet wird die Einläutung des neuen, gesetzteren Lebensabschnitts der alten Rotznase von ihrer Musealisierung, Kanonisierung, und Vereinnahmung als Kunst- und Nationalgeschichte (aktuell z.B. als »Punk London« unter den Auspizien von Königin Elizabeth II, dem Heritage Lottery Fund, und dem unsäglichen Boris Johnson). Man kann dies durchaus als Anlass nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Konzeptionen von Zeitlichkeit bei der Erzählung von Punk als Geschichte zu welchem Effekt zum Einsatz kommen, im Besonderen, welche Rolle dabei die Figur der Wiederholung spielt. Denn ungeachtet der dem Genre immer wieder als immanent zugeschriebenen fundamentalen Nachhaltigkeitsfeindlichkeit (»No Future!«), kehren Punk-Sensibilitäten und –ästhetiken seit vierzig Jahren in den verschiedensten Kontexten immer wieder verlässlich zurück. Um es mit den Buffets (Damaged Goods, 2006) zu sagen: Punk Rock Ist Nicht Tot.
Im gegenwärtigen Popdiskurs wird eine solche Wiederholung eines vermeintlich anachronistischen Styles vor allem als Provokation verhandelt; am prominentesten wohl vom britischen Journalisten Simon Reynolds. Dieser bezichtigt Praktiken der Wiederholung in seinem Buch Retromania: Pop Culture’s Addiction To Its Own Past (2011) des Verrats am Pop an sich. Pop, so Reynolds, sei per definitionem gegenwartsorientiert, seine Essenz wäre »to ‘be here now’, meaning both ‘live like there’s no tomorrow’ and ‘shed the shackles of yesterday’«(2011, xix). Im Gegensatz dazu wäre Wiederholung immer retro: rückwärts gerichtet, nostalgisch im vermeintlichen Ruhm vergangener Epochen verhaftet, bloß an Vereinnahmung, Imitation, Erhaltung und Konservierung interessiert, und somit letztendlich reaktionär.
Mit Punk hat Reynolds allerdings seine liebe Not. Die Zeitlichkeit des Genres lässt sich nämlich schwer mit einer als lineare Fortbewegung projektierten Geschichte in Einklang bringen. Wie Reynold selbst diagnostiziert, bezieht Punk der sogenannten »Gründungsphase«, wie er während der 1970er Jahre in den Vereinigten Staaten zB von Patti Smith, den New York Dolls oder den Ramones personifiziert wird, seine Grundlagen aus einer Wiederholung von Rock-Gesten der 1950er und 1960er Jahre – und ist damit eigentlich retroman. Der tatsächliche Geschichtsverlauf, wenn man so will, straft einer solchen Ansicht allerdings Lügen, wie ja auch Reynolds selbst bemerkt. Immerhin brachte Punk wirklich Veränderung mit sich, und beeinflusste spätere Pop-Praktiken nachhaltig. Reynolds wundert sich:
»How something so incremental and rehearsed became a Year Zero Event is hard to reconstruct in hindsight. That Punk then snowballed into a genuinely transformative, world-historical force is even more puzzling« (2011, 240)
Verwirrt ist Reynolds nicht nur von der transformativen Kraft der anachronistischen Wiederholung von Gesten, sondern auch davon, wie genau die Gegenwart von Punk zu verorten sei. Er tut sich sichtlich schwer, Punk überhaupt ein Gegenwartsmoment zuzugestehen. Das wird vor allem in einem (nicht in Retromania publizierten) Artikel über Martin Revs und Alan Vegas’ Duo Suicide deutlich. Reynold beschreibt den Act als zu Punk für Punk, und damit als Post-Punk avant la lettre, vielleicht sogar als Post-Punk vor Punk:
»Suicide are now so firmly installed in the rock canon, it‘s hard to remember the scorn they once provoked. (...) Some say Suicide were the ultimate punks, because even the punks hated them. In another sense, they were the first postpunk band, jettisoning the sonic trappings of trad rock‘n‘roll and paving the way for guitar-free synthpop outfits like Soft Cell«1
In anderen Worten: Suicide waren deswegen mehr Punk als Punk, weil sie subvertierten, wie Punk-Ästhetiken zu ihren Hochzeiten, den 1970er und frühen 1980er Jahren, zeitgenössisch stimmig umgesetzt und aufgeführt wurden. Man könnte sagen: Suicide sind/waren also Punk (und transformativ), weil sie uneins mit ihrer Zeit waren.
Reynolds nähert sich hier der temporalen Widersprüchlichkeit, die so grundlegend für Punk ist: Punk ist nur dann (pop-)effektiv – das heisst, ikonolastisch, zweifelnd, und Veränderungen anstoßend – wenn seine Performances und Ästhetiken eben nicht in ihrer historischen Zeit aufgehen. Sobald Punk zeitgenössisch passend wird, ist es kein Punk mehr. Es ist also von vorne herein schwierig, Punk in einer linearen Temporalität genau zu verorten. In Punk scheinen sich mehrere unterschiedliche Zeitlichkeiten zu überlagern, damit sich das transformative Potential des Genres überhaupt entfalten kann.
Möchte man eine solche Zeitlichkeit theoretisch fassen, würde sich z.B. Jacques Rancières Konzept der Anachronie anbieten. Dieses Konzept erlaubt es nicht nur, historische Epochen als von vorne herein und in sich selbst temporal uneindeutig und plural zu denken, und Artefakten aus gleichzeitig verschiedenen Zeiten antwortend. Im Gegensatz zur linearen Geschichtsschreibung eines Simon Reynolds – in dem das, was sich auf Früheres bezieht und Früheres in sich trägt, oder Früheres wiederholt und wendet, immer nur altmodisch, anachronistisch und reaktionär sein kann – ist man hier nicht interessiert daran, popkulturelle Äußerungen strikt als entweder zur Vergangenheit oder zur Gegenwart oder zur Zukunft gehörend zu klassifizieren. Das produktive Ineinanderwirken der Zeiten, die nicht nur im Artefakt selbst stattfindet, sondern eben auch in dem lebensweltlichen Kontext, in dem es zirkuliert, kann hier nicht automatisch als abzulehender Fehler, oder zerstörerische Zwangshandlung (»Addiction to the Past«) abgetan werden. Es geht vielmehr darum, wie ich meine, im einzelnen Fall zuerst auf dieses spezifische Ineinanderwirken einzugehen, bevor überhaupt über eventuelle »Effekte« – positive wie negative - auf die Popkultur der Gegenwart gesprochen werden kann.
In Retromania geht Reynolds jedoch nicht weiter auf diese komplexe Zeitlichkeit von Punk ein. Nicht-Linearität und Anachronie interessiert ihn nicht weiter, wie es scheint. Seine Erklärung, warum Punk doch noch ins Revolutionäre kippen konnte, lautet folgendermassen:
»Somewhere in the transition from New York to Britain ... other factors came into play. Unexpected disaffections and ambitions attached themselves to the word ‘punk’, creating a runaway momentum that propelled the movement far beyond what people like Greg Shaw and Lester Bangs, the [New York] Dolls or the Ramones ever envisioned. Musical influences from outside rock’n’roll, as well as non-musical catalysts from the world of politics, art theory and avant-garde fashion, entered the picture. Everything came together in a surge of energy, and then, Big-Bang-like, exploded outwards into new galaxies of sound and subculture« (2011, 257f).
Während einigen Aspekten dieser Darstellung sicher zuzustimmen ist – vor allem die Hervorhebung des Sozialen und Musik-Übergreifenden, ohne dem es wohl nicht zu den weitreichenden Veränderungen von (sub-)kulturellen Landschaften mit/im/nach Punk gekommen wäre – bedient Reynolds hier allerdings auch zweifelhafte Rhetoriken, die Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit in den Dienst von Fortschritt und Eroberung stellen. Die »Explosion« in »neue Galaxien« durch einen »Big Bang« ungeklärten – und unerklärbaren – Ursprungs klingt (wenn man ungnädig sein will) entweder biblisch oder kolonial. Mein Punkt: Eine solche Darstellung der Geschichte von Punk bringt uns in den 2010er-Jahren nichts Neues mehr bei, sondern haut in eine Kerbe, die sich mittlerweile als klischeehafter Gründungsmythos des Genres etablieren konnte.
In dieser Klischee-Geschichte wird Punk zu einer Figur, deren transformatives Potential ausschließlich seiner historischen Epoche geschuldet ist, damit komplett in dieser Epoche aufgeht, und somit in einem anderen historischen Kontext auch nicht wiederholbar ist. Polemisch zugespitzt könnte man behaupten: eine solche Erzählung der Geschichte von Punk gleicht dem »Schlachtengemälde« der Historienmalerei, das, wie Maria Muhle treffend zusammenfasst, »große Männer bei großen Taten zeigen« soll. Für verschiedene unzeitgemäße Ästhetiken und Performances ergibt sich durch eine solche Betrachtungsweise eine recht unterschiedliche Wertigkeit: »Zu-Früh«-Sein, wie etwa das von Suicide, ist wertvoll, da diese Unzeitgemäßheit mit den üblichen Tugenden wegerklärt werden kann, die (vor allem männlicher) künstlerischer Produktion gerne zugeschrieben werden – ich denke hier an Genie, Wahnsinn, visionäre Transgression, avant-garde. »Zu-Spät«-sein wird im Gegensatz dazu entwertet, da es vermeintlich nur den großen Taten und dem Ruhm vergangener Epochen nachhechelt, anstatt neue, eigene Epochen mit eigenen großen Taten einzuläuten– enter retro.
Und das bringt uns zu wiederholenden Aneignungspraxen. Wie man weiß, scheren sich viele Praktizierende wenig um diese Wertzuschreibungen. Punk erschöpft sich nicht in Reynolds’ »Original-Urknall« der 1970er, sondern lebt äußerst nachhaltig weiter. Gewisse dem Genre zugeordnete Ästhetiken kehren wieder, gerade weil sie ein Versprechen transportieren zu scheinen, das weit über ihre historischen Produktionskontexte hinaus gültig scheint. Sie scheinen beinahe zum Covern und Umarbeiten zu animieren – fröhlich über die Jahrzehnte hinweg.
Für mich liegt die Sprengkraft dieser Wieder-Aufführungen genau im Repetitiven. Diese sich wiederholende und monotone Qualität ist schon in der Nummer von 1977 angelegt, vervielfacht sich aber mit den vielen späteren Appropriationen, und macht damit eine andere Erfahrung der Geschichtlichkeit von Punk möglich. An die Stelle des »Schlachtengemäldes« – mit seinen »großen Männern« als zentrale Akteure, deren transformative Genialität nie wieder erreicht werden kann – tritt eine Erfahrung von geteilter Schaffenskraft, von sich gegenseitig beeinflussenden Interferenzen und von Verknüpfungen, die Zeit falten wie einen Strudel. Geschichte, auch die Geschichte von Punk, ist plötzlich nicht mehr abgeschlossen, sondern lebending, veränder- und verhandelbar. Das Potential von Punk-Ästhetiken – im hier diskutierten Fall wesentlich durch Reduktion und Repetition bestimmt – kann springen, Funken schlagen, und sich an der Stelle und zu einer späteren Zeit wieder anbieten. Simple Ableitungen sind solche Wiederholungen insofern nicht, weil der Ausgang dieser Versuche, das Potential der Ghost-Rider-Monotonie wieder und wieder zum Ausbruch zu bringen, schließlich von Mal zu Mal ungewiss bleibt. Und das ist Pop w/Potentiality.
Literatur
Maria Muhle (2013), »History Will Repeat Itself. Für eine (Medien-)Philosophie des Reenactment.« In: Lorenz Engell, Frank Hartmann, Christiane Voss (Hg.), Körper des Denkens. Neue Positionen der Medienphilosophie, München: Fink, 113-134
Jacques Rancière (2015), »The Concept of Anachronism and the Historian’s Truth« (1996), trans. Tim Stott & Noel Fitzpatrick, In/Print 3 (Dublin Institute of Technology), 21-48.
Simon Reynolds (2011), Retromania. Pop Culture’s Addiction To Its Own Past, London: Faber & Faber
[1] Reynolds, 2002, http://www.villagevoice.com/news/suicide-watch-6414502