"Du sollst mir Enkel schenken" von
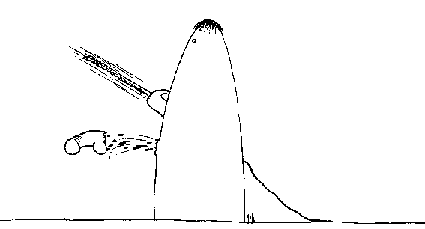 Das Bühnenbild
läßt wenig Fragen offen. Eine gemusterte Höhle mit spitzzulaufenden
Einstülpungen an der Seite, in den Raum geschwungene Rohre, ein kleines
und ein großes Loch geradeaus und links und rechts ein großer
schwarzer Strich mit kleinen Querstrichen. Wir sitzen im Unterleib einer
"ausgeräumten" Frau. Muskeln, Zysten, Narben - alles da.
Wir sitzen im Theater Phönix und erleben die Oberösterreichpremiere
des Zweiakters "Du sollst mir Enkel schenken" von Thomas Jonigk.
Das Bühnenbild
läßt wenig Fragen offen. Eine gemusterte Höhle mit spitzzulaufenden
Einstülpungen an der Seite, in den Raum geschwungene Rohre, ein kleines
und ein großes Loch geradeaus und links und rechts ein großer
schwarzer Strich mit kleinen Querstrichen. Wir sitzen im Unterleib einer
"ausgeräumten" Frau. Muskeln, Zysten, Narben - alles da.
Wir sitzen im Theater Phönix und erleben die Oberösterreichpremiere
des Zweiakters "Du sollst mir Enkel schenken" von Thomas Jonigk.Es geht um die Geschichte einer Mutter, der bei der Geburt des zweiten Sohnes die Gebärmutter entfernt wurde. Dabei hätte sie noch viele, viele stramme, blonde, blauäugige Söhne in die Welt setzen wollen. Jetzt verlangt sie von eben diesem Sohn, daß er ihr Enkel schenkt, damit der Weiterbestand ihrer Erbanlagen gesichert ist. Nun ist aber dieser Sohn schwul und mag sich nicht an "schwachsinnige Frauenschenkel" verschwenden und wir sitzen da und schauen zu, welche Machtmechanismen im Kampffeld Familie wirksam werden. Und weil wir wissen, daß die Familie die Keimzelle des Staates ist und im Kleinen das wiederspiegelt, was sich im Großen - in der Gesellschaft - tut, wissen wir natürlich auch, daß es in diesem Stück um mehr geht als um den Spleen und die Finten einer dominanten Übermama.
 Aber
das Stück ist nicht gut. Es zieht sich gewaltig. In der Kunstsprache
des Thomas Jonigk mag ja hin und wieder feine Ironie durchschimmern, manchmal
blitzt auch beißender Spott, "Ich bin Mutter und aromatisch",
aber ein paar witzige, im Schwab'schen Sinn verschraubte Formulierungen
tragen noch kein ganzes Stück. Und die (bourgeoise) Familie vorzuführen
und dann an ihr.............ja was denn eigentlich zu zeigen?, ist weder
böse noch satirisch. So ist der Schwule auch kein Guter, sondern ein
blöder, von der Mutter käuflicher Macho. Und so wird halt vorgezeigt
und hingewiesen und die angehende freßsüchtige Verlobte des
Herrn Schwulen redet als Soziologin zwar gescheit daher, will in Wirklichkeit
aber auch nichts anderes als von irgendjemand schnell ein Kind, damit sie
endlich dazugehören kann und ihre Rolle in der Gesellschaft über
den Nachwuchs definieren darf, womit wir wieder bei der Mutter sind, die
zwischenzeitlich dem Sohn das Schwulsein erlaubt, weil sie Angst vor dem
Alleinsein hat und im nächsten Atemzug wieder für die Ausmerzung
des Artfremden, des "Sodomiten" eintritt. Gestört sind sie
alle, fremdbestimmt und korrupt und der Pfarrer hängt auch mit drin.
Das Blöde ist, daß wir das alles wissen und Thomas Jonigk dem
auch keine neuen Facetten hinzufügt. Nun denn.
Aber
das Stück ist nicht gut. Es zieht sich gewaltig. In der Kunstsprache
des Thomas Jonigk mag ja hin und wieder feine Ironie durchschimmern, manchmal
blitzt auch beißender Spott, "Ich bin Mutter und aromatisch",
aber ein paar witzige, im Schwab'schen Sinn verschraubte Formulierungen
tragen noch kein ganzes Stück. Und die (bourgeoise) Familie vorzuführen
und dann an ihr.............ja was denn eigentlich zu zeigen?, ist weder
böse noch satirisch. So ist der Schwule auch kein Guter, sondern ein
blöder, von der Mutter käuflicher Macho. Und so wird halt vorgezeigt
und hingewiesen und die angehende freßsüchtige Verlobte des
Herrn Schwulen redet als Soziologin zwar gescheit daher, will in Wirklichkeit
aber auch nichts anderes als von irgendjemand schnell ein Kind, damit sie
endlich dazugehören kann und ihre Rolle in der Gesellschaft über
den Nachwuchs definieren darf, womit wir wieder bei der Mutter sind, die
zwischenzeitlich dem Sohn das Schwulsein erlaubt, weil sie Angst vor dem
Alleinsein hat und im nächsten Atemzug wieder für die Ausmerzung
des Artfremden, des "Sodomiten" eintritt. Gestört sind sie
alle, fremdbestimmt und korrupt und der Pfarrer hängt auch mit drin.
Das Blöde ist, daß wir das alles wissen und Thomas Jonigk dem
auch keine neuen Facetten hinzufügt. Nun denn.Das Ensemble des Phönix hat sich redlich bemüht, diesem Stück, an dem sich im vergangenen Jahr auch schon das Schauspielhaus abgemüht hat, doch noch schärfere Konturen zu verpassen.
Viele Varianten wurden durchgespielt, geprobt und wieder verworfen. Schließlich wurde ein neuer Schluß erarbeitet - in der Originalfassung fügt sich der schwule Sohn nach langem Hin und Her zuletzt doch dem Fortpflanzungsbefehl seiner Mutter - und durch einen bewußten Bruch nach dem 1. Akt die Aufführung gerettet.
 Schlechte
Kritiken sollten nicht daran hindern, sich das Stück anzuschauen.
Denn wo das Stück fad wird, werden Schauspiel- und Regiearbeit spannend.
Das Phönix Team hat wieder einmal trotz aller Hemmnisse und Schwierigkeiten
gezeigt, daß das Theater keine anachronistische Anstalt ist. Renate
Köhn, als gewalttätige, für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen
mit allen Mitteln agierende Mutter, Christian Lemperle als selbstverliebter,
frauenverachtender schöner und schwuler Sohn, Andre Settembrini als
frauenverachtender braver Sohn Klaus, Andreas Pühringer als verschlagener
und schleimender Pfarrer, Sabine Kistler als geile Patentante und Maria
Schwarz als verfressene Heiratskandidatin machen mit ihrer Arbeit das wett,
was dem Stück an Substanz fehlt. Eine feine Gesellschaft, die in schweißtreibenden,
schrillen Kostümen von Gertrude Saxinger und in der Maske von Peter
Köfler ihr wahres Gesicht zeigt. Das Bühnenbild stammt von Georg
Lindorfer, für die Regie ist Georg Staudacher verantwortlich.
Schlechte
Kritiken sollten nicht daran hindern, sich das Stück anzuschauen.
Denn wo das Stück fad wird, werden Schauspiel- und Regiearbeit spannend.
Das Phönix Team hat wieder einmal trotz aller Hemmnisse und Schwierigkeiten
gezeigt, daß das Theater keine anachronistische Anstalt ist. Renate
Köhn, als gewalttätige, für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen
mit allen Mitteln agierende Mutter, Christian Lemperle als selbstverliebter,
frauenverachtender schöner und schwuler Sohn, Andre Settembrini als
frauenverachtender braver Sohn Klaus, Andreas Pühringer als verschlagener
und schleimender Pfarrer, Sabine Kistler als geile Patentante und Maria
Schwarz als verfressene Heiratskandidatin machen mit ihrer Arbeit das wett,
was dem Stück an Substanz fehlt. Eine feine Gesellschaft, die in schweißtreibenden,
schrillen Kostümen von Gertrude Saxinger und in der Maske von Peter
Köfler ihr wahres Gesicht zeigt. Das Bühnenbild stammt von Georg
Lindorfer, für die Regie ist Georg Staudacher verantwortlich.Nach der Pause finden sich die Zuschauer wieder im Theatersaal ein, auf der Bühne sammeln sich die Verlobungsgäste. Aber was liegt da auf dem Tisch? Ein elektrisches Küchenmesser. Bitte nicht, denken wir, aber das Unvermeidliche ist unvermeidlich. Nach langem Hin und Her, beim zweiten Ansetzen macht der schwule Sohn, was er glaubt, tun zu müssen. Die Regie ist unerbittlich. Es ist wie im Film. Wie in dem mit Gerard Depardieu. Wie im Film trauen wir uns nicht richtig hinschauen und denken stattdessen über Sätze wie folgende nach: "In eine Frau, die Forderungen stellt, wird keiner Feste feiern, wie sie fallen". Später werden wir lesen, daß das Stück frauenfeindlich ist. Wir sehen das anders.